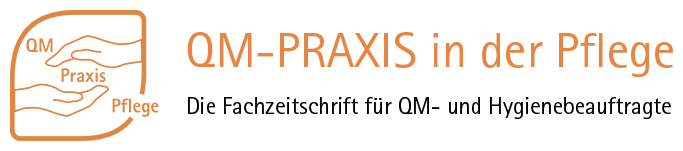Ausgabe Juni 2025
AUSZUG AUS DEM INHALT:
TITELTHEMA
Hitzeschutz in Pflegeeinrichtungen aus hygienischer Perspektive
Hitzewellen treten durch den Klimawandel immer häufiger und intensiver auf. Besonders betroffen sind vulnerable Gruppen wie ältere und pflegebedürftige Menschen, deren Körper nur eingeschränkt auf hohe Temperaturen reagieren können. Für Pflegeeinrichtungen ergeben sich neben den direkten gesundheitlichen Risiken durch Hitze auch hygienische Herausforderungen. Hohe Temperaturen und eine erhöhte Luftfeuchtigkeit wirken sich nicht nur negativ auf den menschlichen Organismus aus, sondern verändern auch die hygienerelevanten Bedingungen in Pflegeeinrichtungen. Hitze kann die Vermehrung von Infektionserregern begünstigen, die Haltbarkeit von Lebensmitteln verkürzen und die Sicherheit von Medikamenten gefährden. Überdies steigt das Risiko für Hautinfektionen, Schimmelbildung, Schädlingsbefall und ungünstige Veränderungen der Trinkwasserqualität. Ein umfassendes Hitzeschutzkonzept für Pflegeeinrichtungen muss daher gesundheitliche, infrastrukturelle und hygienische Aspekte berücksichtigen, um Bewohner und Mitarbeitende gleichermaßen zu schützen.
Pflege von Menschen mit Migrationshintergrund – Interkulturelle Sensibilität als Qualitätsmerkmal
Pflegeeinrichtungen stehen heute mehr denn je vor der Herausforderung, interkulturelle Vielfalt aktiv in ihre Arbeitsprozesse zu integrieren. Dabei geht es nicht nur um persönliche Haltung, sondern auch um die Frage: Wie wird interkulturelle Sensibilität zum Bestandteil professioneller Pflegequalität – und damit auch des Qualitätsmanagements?
AKTUELLES
Pflege und Gesundheitsversorgung neu denken – Meinungen und Eindrücke aus unterschiedlichen Perspektiven
Vor einiger Zeit haben wir eine Serie ins Leben gerufen, in der wir Einschätzungen zur aktuellen Situation der Pflege aus unterschiedlichen Professionen, Bereichen und Blickwinkeln Raum geben möchten. Wir freuen uns sehr, dass wir für diese Ausgabe Mark Grabfelder, Professor Christian Rester und Prof. Jürgen Zerth dafür gewinnen konnten, unsere Fragen zu beantworten und sich darüber auszutauschen. Die drei haben im Rahmen einer gemeinsamen öffentlichen Ausschreibung zusammengefunden. Die Erkenntnisse, die sich ihnen dabei im interdisziplinären Diskurs erschlossen haben, was unsere zukünftige Gesundheitsversorgung ausmacht, haben sie in einem Fachbeitrag zusammengefasst. Diesen Fachbeitrag „Kommunale Daseinsvorsorge im Sozialraum im Sinne einer vernetzten Sorgeidee …“können Sie in der April-Ausgabe der QM-PRAXIS nachlesen. Erfahren Sie im vorliegenden Interview nun noch ausführlicher, wie die Autoren unsere aktuelle und zukünftige Gesundheitsversorgung einschätzen und welche Lösungsvorschläge sie anbieten.
Sozioökonomische Unterschiede in der Lebenserwartung zwischen Deutschlands verschiedenen Regionen
Die Lebenserwartung in Deutschland gilt als übergreifender Indikator für die Bevölkerungsgesundheit, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Versorgungsqualität. Gemäß der jüngsten Periodensterbetafel 2021/ 2023 erreichen Männer in Deutschland durchschnittlich ein Lebensalter von 78,2 Jahren und Frauen von 83,0 Jahren (vgl. Destatis 2024a, S. 7). Hinter diesen Mittelwerten verbergen sich jedoch ausgeprägte regionale Unterschiede, die sehr eng mit dem Einkommen, der Bildung und der jeweils vorhandenen Infrastruktur verknüpft sind. So sterben Männer in den sozioökonomisch stärksten Kreisen im Mittel sieben Jahre später als jene in strukturell schwachen Kreisen, bei Frauen beträgt die Differenz rund vier Jahre (Hoebel 2025, S. 5). Die COVID-19-Pandemie hat diese Kluft zusätzlich vergrößert, weil Infektionsrisiken, Vorerkrankungslasten und Zugangsbarrieren in benachteiligten Räumen als zusätzliche Sterberisiken hervortraten (vgl. BiB 2024, S. 4).
SCHULUNG / KOMMUNIKATION / MOTIVATION
Mitarbeiterschulung leicht gemacht – Aktuelles Wissen adäquat vermitteln
Mitarbeiterschulungen gehören zum Pflegealltag – und doch werden sie im stressigen Tagesgeschäft häufig als lästige Pflicht wahrgenommen. Zwischen Dokumentationsdruck, Personalmangel und kurzfristigen Ausfällen scheint für strukturierte Schulungsprozesse oft kaum Zeit zu bleiben. Dabei liegt gerade hier ein entscheidender Hebel für Qualitätssicherung, Sicherheit und Weiterentwicklung in der stationären Pflege. Dieser Beitrag zeigt auf, wie Schulungen strategisch geplant, didaktisch wirksam gestaltet und im Sinne des Qualitätsmanagements evaluiert werden können. Mit einem klaren Fokus auf Umsetzbarkeit im Alltag – und dem Ziel, aus Pflicht echten Mehrwert zu machen.
RECHTLICHES / GESETZGEBUNG AKTUELL
Die Krankenhaustransformationsfonds-Verordnung (KHTFV)
Mit dem Krankenhaustransformationsfonds-Verordnung (KHTFV) ist der Transformationsfonds eines der zentralen Instrumente der aktuellen Krankenhausreform. Die dazugehörige Verordnung – die Krankenhaustransformationsfonds-Verordnung (KHTFV) – regelt im Detail, wie Fördermittel von bis zu 50 Milliarden Euro eingesetzt werden dürfen. Ziel ist es, eine bedarfsgerechte, qualitativ hochwertige und wirtschaftlich tragfähige Versorgungsstruktur aufzubauen. Diese umfassende Strukturreform eröffnet neue Handlungsspielräume für Krankenhausträger, erfordert aber gleichzeitig eine sorgfältige Planung und Koordination mit den Ländern.
PFLEGEPRAXIS
Ethische Herausforderungen in der Pflege – Was Leitungskräfte beachten sollten
Ethische Fragen gehören zum Pflegealltag – und doch werden sie selten offen thematisiert. Entscheidungen unter Zeitdruck, schwierige Situationen mit pflegebedürftigen Personen, Konflikte im Team oder mit Angehörigen: Oft schwingen ethische Dilemmata im Hintergrund mit, ohne dass sie bewusst benannt werden. Dabei sind es gerade diese stillen Spannungsfelder, die langfristig Unzufriedenheit, Überforderung und Unsicherheit im Team fördern können. Leitungskräfte stehen hier in einer besonderen Verantwortung: Sie prägen nicht nur die Organisation, sondern auch den Umgang mit ethischen Fragestellungen. Dieser Beitrag beleuchtet, wie ethische Konflikte im Pflegealltag erkannt, strukturiert und lösungsorientiert bearbeitet werden können – und welche Rolle Führungskräfte dabei spielen. Denn: Gelebte Ethik beginnt nicht bei der Theorie, sondern in der konkreten Handlung – und braucht dafür Orientierung, Klarheit und den Mut zum Dialog.
Einsamkeit: Das Grundbedürfnis nach sozialen Beziehungen
Viele Menschen sind häufig allein, fühlen sich aber nicht einsam. Umgekehrt können sich auch Menschen einsam fühlen, die viele soziale Kontakte in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule oder in sozialen Einrichtungen haben. Das Gefühl der Einsamkeit hängt also nicht von der Anzahl der Menschen ab, die einen umgeben. Es ist vielmehr eine Frage der subjektiven Wahrnehmung des eigenen Lebens und der eigenen Rolle, und zwar unabhängig vom Alter. Anhaltende Einsamkeit kann jedoch die psychische und physische Gesundheit beeinträchtigen. Von Einsamkeit sind häufig ältere und pflegebedürftige Menschen sowie pflegende Angehörige betroffen. Welche Risiken Einsamkeit mit sich bringen kann und welche Angebote es gibt, um aus der Einsamkeit herauszufinden, wird im folgenden Artikel beschrieben.
DIGITALISIERUNG
Change Management und die digitale Transformation
Dieser Beitrag stellt Change Management in Bezug auf digitale Transformation allgemein und branchenunabhängig dar. Insofern werden Beispiele und teilweise Begrifflichkeiten aus der Wirtschaft verwendet. Die Inhalte lassen sich auf Transformationsprojekte in Pflege- und Gesundheitseinrichtungen übertragen. Erstens sind diese Einrichtungen immer stärker wettbewerbsorientiert und zweitens sind die Praxistipps und Erläuterungen für diese Einrichtungen ebenso anwendbar und bieten hilfreiche Einblicke für Veränderungsprozesse.
„Warum“ und nicht „Wie“
Vor einigen Tagen hatte ich das große Glück, im Rahmen des Bayerischen E‐Health Kongresses einem Vortrag von Samuel Koch beiwohnen zu dürfen. Titel: „Plötzlich pflegebedürftig? Ein Plädoyer für Zukunftsfreude“. Ich sage „großes Glück“, denn allein für diesen Vortrag hat sich der Besuch des Kongresses gelohnt. Samuel Koch ist es gelungen, auf unglaublich charismatische Weise nicht nur ein Plädoyer für Zukunftsfreude, sondern auch für die Pflege zu halten und die gesamte Zuhörerschaft in seinen Bann zu ziehen und zu bewegen. So etwas gelingt nicht vielen Menschen. Dabei hat er mehrfach eines betont: Es ist wichtig, nicht das „Wie“, sondern das „Warum“ in den Vordergrund zu stellen.
Das gilt besonders auch für Pflegeberufe: „Warum habe ich mich eigentlich für diese „Berufung“ entschieden?“ Wenn es Ihnen gelingt, sich auf diese Frage zu besinnen, so Samuel Koch, dann wird es vielleicht oft leichter, das „Wie mache ich etwas?“ gelassener und mutiger anzugehen und sich nicht deswegen zu „verkopfen“. Oder anders gesagt: „Wer nichts tut, kann nichts falsch machen – aber auch nichts richtig.“
Dieses Motto findet sich auch in der vorliegenden Ausgabe wieder. Sei es im Hinblick auf den Artikel zu ethischen Herausforderungen in der Pflege oder aber in unserem Interview „Pflege und Gesundheitsversorgung neu denken – Meinungen und Eindrücke aus unterschiedlichen Perspektiven“, das ich Ihnen ganz besonders ans Herz legen möchte.
Fragen Sie also gelegentlich nach dem „Warum“ und seien Sie öfter mutig. Und besuchen Sie einen Vortrag von Samuel Koch, wenn sich Ihnen die Gelegenheit dazu bietet.
Mit herzlichen Grüßen
Ihre Mirjam Lang
Redaktion „QM-PRAXIS in der Pflege“