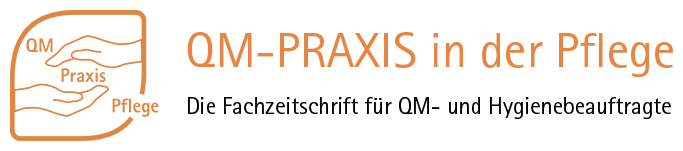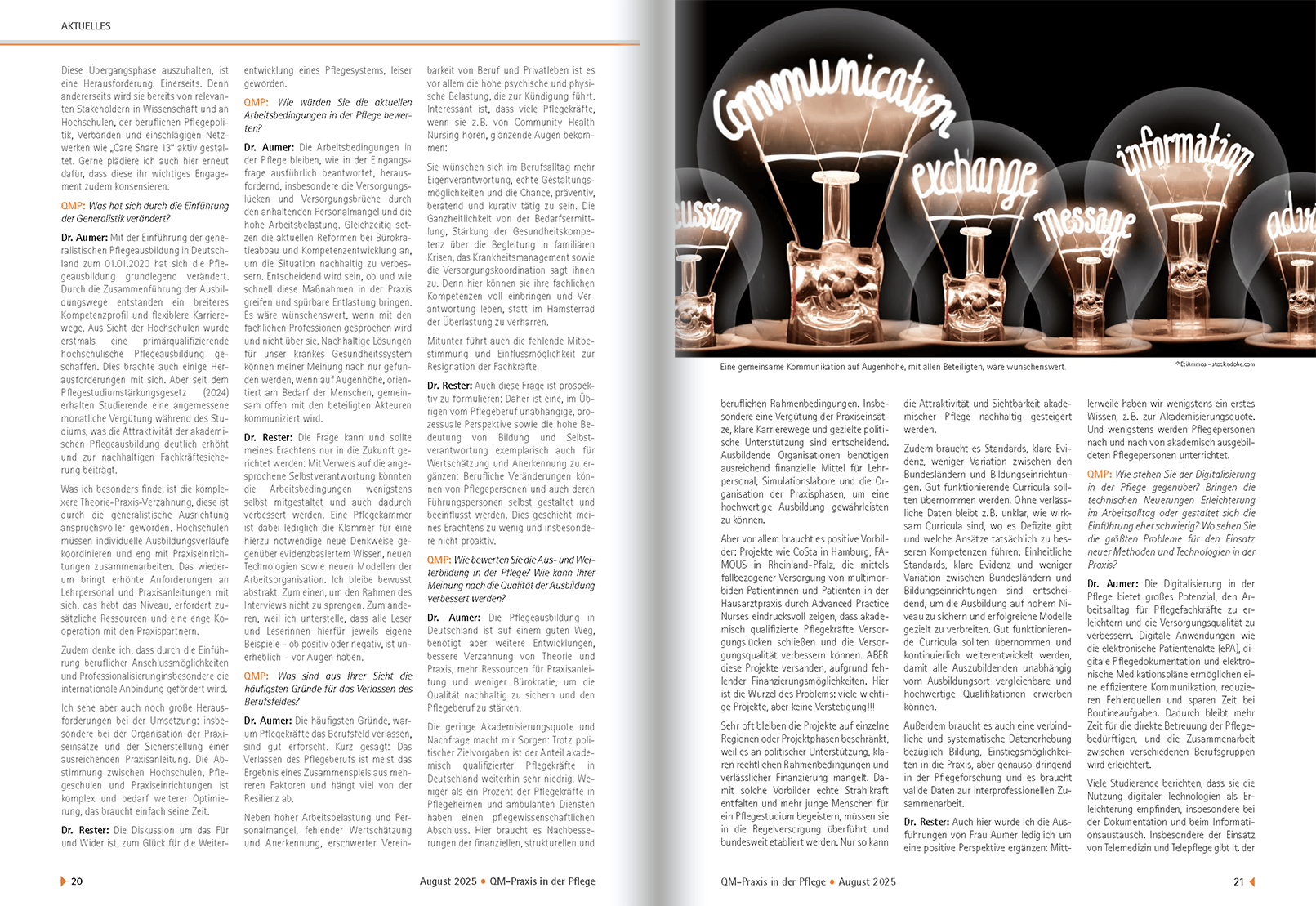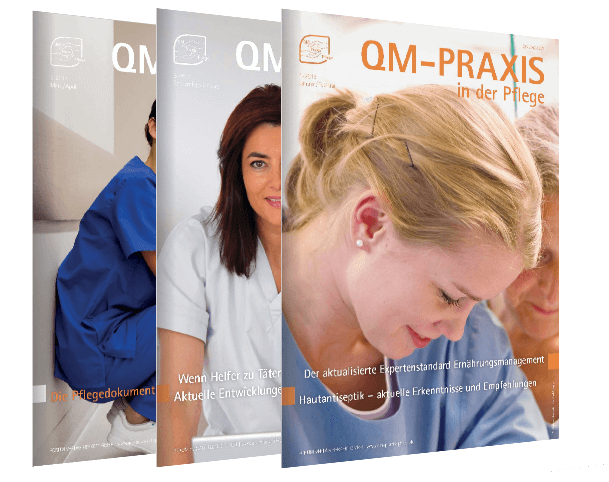AKTUELL
Pflege und Gesundheitsversorgung neu denken – Meinungen und Eindrücke aus unterschiedlichen Perspektiven
Text: Mirjam Lang (Redaktion QM-PRAXIS) im Gespräch mit Dr. Christine Aumer und Dr. David Rester | Foto (Header): © miss irine – stock.adobe.com
Wir freuen uns, dass wir ergänzend zu dem Interview in der Juni-Ausgabe der QM-PRAXIS noch ein zweites Gespräch mit zwei weiteren Autoren des kürzlich in unserem Magazin veröffentlichten Fachbeitrags „Kommunale Daseinsvorsorge im Sozialraum im Sinne einer vernetzten Sorgeidee …“ führen konnten, Frau Dr. Christine Aumer und Herrn Dr. David Rester. Frau Dr. Aumer und Herr Dr. Rester kennen sich seit ihrer gemeinsamen Promotionsphase und stehen im regelmäßigen Austausch zum Thema Community Health Nursing (CHN), auch im Rahmen der Hochschullehre bei Pflegestudierenden an der Technischen Hochschule Deggendorf und der Universität UMIT in Hall in Tirol. Aus einer gemeinsamen Idee der beiden wurde ein geteiltes Anliegen: Beide verbindet ein tiefes berufliches Verständnis für die Herausforderungen unserer heutigen Versorgungsrealitäten. Gemeinsam eint sie das Ziel, Menschen in Sorgesituationen oder Krisen zu stärken und tragfähige Strukturen zu schaffen, die ein Verbleiben im vertrauten häuslichen Umfeld ermöglichen. Ihre Zusammenarbeit ist geprägt von dem festen Willen, Versorgung neu zu denken – weg von fragmentierten Zuständigkeiten, hin zu einer vernetzten, sozialraumorientierten Sorgepraxis. Als Teil des Konsortiums zur „Sorgeidee“ bringen sie ihre Perspektiven ein und engagieren sich für eine kommunal verankerte Daseinsvorsorge, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt.
Auszug aus:
QM Praxis in der Pflege
Ausgabe August 2025
Jetzt Leser/-in werden
QMP: Wie würden Sie den aktuellen Zustand des Pflegesystems in Deutschland aus Ihrer Perspektive beschreiben?
Dr. Aumer: Das Pflegesystem in Deutschland steht an einem kritischen Punkt: Die Herausforderungen durch Fachkräftemangel, demografischen Wandel und Finanzierungslücken sind gravierend und verschärfen sich weiter. Die Politik scheint die Probleme erkannt zu haben und hat wichtige Reformen auf den Weg gebracht, doch die Umsetzung und nachhaltige Wirkung dieser Maßnahmen müssen sich erst noch beweisen. Ohne rasches und entschlossenes Handeln droht eine Verschärfung der Versorgungskrise – die kommenden Jahre werden entscheidend sein, ob das System zukunftsfest gemacht werden kann. Insgesamt braucht es eine Stärkung des ambulanten und häuslichen Bereichs, um Versorgungslücken entgegenwirken zu können.
Dr. Rester: Den Ausführungen der Kollegin ist zuzustimmen. Zu ergänzen wäre lediglich, dass wir weiterhin im System selbst verfangen sind. Das ist nicht ungewöhnlich. Denn Systeme versuchen, sich selbst zu erhalten. Exemplarisch werden weiterhin die Sektorengrenzen ambulant und stationär aufrechterhalten sowie Gesundheitsförderung und Prävention nur marginal berücksichtigt. Darüber hinaus gelingt strukturell und operativ die – z. B. edukative – Einbindung informell Sorgender und Pflegender kaum.
QMP: Was sind Ihrer Einschätzung nach aktuell die größten Hürden, mit denen die Pflege- und Pflegekräfte zu kämpfen haben?
Dr. Aumer: Die größten Hürden, mit denen Pflege und Pflegekräfte aktuell in Deutschland zu kämpfen haben, lassen sich aus meiner Sicht wie folgt zusammenfassen:
- Massiver Fachkräftemangel: Der Bedarf an Pflegekräften steigt kontinuierlich, während die Zahl der verfügbaren Fachkräfte nicht mithält. Bis 2049 könnten lt. Bundesagentur für Arbeit zwischen 280.000 und 690.000 Pflegekräfte fehlen.
- Überlastung und Arbeitsbedingungen: Viele Pflegekräfte empfinden ihre Arbeitsbelastung als zu hoch und die Arbeitsbedingungen als unzureichend, vor allem hohe Arbeitsintensität, Zeitdruck und hoher Bürokratieaufwand führen häufig zu Stresserleben und gesundheitlichen Problemen. Dies erschwert auch die Gewinnung und Bindung neuer Fachkräfte.
- Eingeschränkte Kompetenzen: Pflegekräfte berichten, dass sie ihre Kompetenzen nicht voll ausschöpfen können. Im internationalen Vergleich haben Pflegefachpersonen in Deutschland weniger Befugnisse, was ihre Motivation und die Versorgungsqualität hemmt (Deutscher Pflegerat, 2024).
- Wachsende Versorgungslücken: Aufgrund des demografischen Wandels steigt die Zahl der Pflegebedürftigen, während gleichzeitig die Anzahl der versorgenden Fachkräfte sinkt. Nicht nur Heimplätze werden knapp und viele Menschen finden keinen Pflegeplatz in Wohnortnähe, sondern landen auf Wartelisten, was die Versorgungssicherheit gefährdet. Auch die Entwicklung bei den praktizierenden Hausärzten verschärft sich. Prognosen der Robert Bosch Stiftung zeigen, dass bis 2035 rund 11.000 Hausärzte fehlen werden. Besonders betroffen sind ländliche Regionen, aber zunehmend auch städtische Gebiete. In etwa 40 Prozent aller Landkreise wird eine Unterversorgung oder eine Bedrohung durch Unterversorgung erwartet. In einigen Regionen könnte die Zahl der Hausärzte bis 2035 um rund 50 Prozent zurückgehen (Monitor Versorgungsforschung 2021).
- Versorgungsbrüche und fehlende sektorübergreifende Koordination: Die Trennung der Rechtsgrundlagen erschwert die Verzahnung von medizinischer Versorgung (SGB V) und Pflege (SGB XI). Dies führt zu Versorgungslücken, insbesondere beim Übergang vom Krankenhaus in die häusliche Pflege oder zwischen ambulanten und stationären Leistungen.
- Umsetzung von Entwicklungsmöglichkeiten: Die Umsetzungsmöglichkeiten von beruflichen Perspektiven sind bislang begrenzt, noch ist oft unklar, wie akademisch ausgebildete Fachkräfte in der Pflege oder in den angrenzenden Wissenschaften einzusetzen sind und vor allem, wie sie refinanziert werden können. Daran zu arbeiten und praxisnah neue Wege zu gehen, erfordert Mut, fördert aber in meinen Augen die Attraktivität des Berufs, ermöglicht eine Zusammenarbeit der Akteure auf Augenhöhe und stellt eine internationale Anbindung dar. In der Vertiefung neuer Rollen wie Advanced Practice Nursing oder Community Health Nursing (CHN) liegt der Schlüssel für eine qualitativ hochwertige Versorgung.
- Fehlende Pflegekammer: In den meisten Bundesländern gibt es keine flächendeckende, verbindliche Pflegekammer. Dadurch fehlt der Pflege eine starke, eigenständige berufsständische Vertretung, wie sie andere Heilberufe (z. B. Ärzte, Apotheker) haben. Ohne Pflegekammer können Pflegekräfte ihre Interessen und Belange auf politischer Ebene nur eingeschränkt vertreten. Dies erschwert die Durchsetzung besserer Arbeitsbedingungen, die Entwicklung von Standards und die Professionalisierung des Berufsstandes.
Dr. Rester: Danke für die umfassende und treffende Analyse, Frau Aumer. Die Pflege und Pflegepersonen haben auch mit sich selbst zu kämpfen. Dazu knüpfe ich ergänzend an der fehlenden Verkammerung der beruflichen Pflege an. Diese würde, in aller Kürze, die Selbstverantwortung der Berufsgruppe und in der Folge die individuelle Berufsausübung von Pflegepersonen stärken. Selbstverantwortetes Handeln wiederum ermöglicht exemplarisch gesundheitlichen Selbstschutz und kontinuierlichen Kompetenzerwerb als Grundlage für eine professionelle Berufsausübung; auch in der Wahrnehmung von Dritten und anderen Berufsgruppen. Von Vorteil ist, dass beruflich Pflegende verantwortlich handeln. Zur Übernahme einer umfänglichen Selbstverantwortung sind für den Kipppunkt jedoch noch nicht ausreichend Pflegepersonen bereit.
Die berufliche Pflege befindet sich in einer Übergangsphase und es wird noch einige Jahre dauern, bis das Pflegeberufegesetz und andere legislative Vorhaben sowie die weitere Akademisierung und neuere Versorgungsansätze, exemplarisch ein CHN, ihre Wirkung entfalten können.
Diese Übergangsphase auszuhalten, ist eine Herausforderung. Einerseits. Denn andererseits wird sie bereits von relevanten Stakeholdern in Wissenschaft und an Hochschulen, der beruflichen Pflegepolitik, Verbänden und einschlägigen Netzwerken wie „Care Share 13“ aktiv gestaltet. Gerne plädiere ich auch hier erneut dafür, dass diese ihr wichtiges Engagement zudem konsensieren.
QMP: Was hat sich durch die Einführung der Generalistik verändert?
Dr. Aumer: Mit der Einführung der generalistischen Pflegeausbildung in Deutschland zum 01.01.2020 hat sich die Pflegeausbildung grundlegend verändert. Durch die Zusammenführung der Ausbildungswege entstanden ein breiteres Kompetenzprofil und flexiblere Karrierewege. Aus Sicht der Hochschulen wurde erstmals eine primärqualifizierende hochschulische Pflegeausbildung geschaffen. Dies brachte auch einige Herausforderungen mit sich. Aber seit dem Pflegestudiumstärkungsgesetz (2024) erhalten Studierende eine angemessene monatliche Vergütung während des Studiums, was die Attraktivität der akademischen Pflegeausbildung deutlich erhöht und zur nachhaltigen Fachkräftesicherung beiträgt.
Was ich besonders finde, ist die komplexere Theorie-Praxis-Verzahnung, diese ist durch die generalistische Ausrichtung anspruchsvoller geworden. Hochschulen müssen individuelle Ausbildungsverläufe koordinieren und eng mit Praxiseinrichtungen zusammenarbeiten. Das wiederum bringt erhöhte Anforderungen an Lehrpersonal und Praxisanleitungen mit sich, das hebt das Niveau, erfordert zusätzliche Ressourcen und eine enge Kooperation mit den Praxispartnern.
Zudem denke ich, dass durch die Einführung beruflicher Anschlussmöglichkeiten und Professionalisierung insbesondere die internationale Anbindung gefördert wird.
Ich sehe aber auch noch große Herausforderungen bei der Umsetzung: insbesondere bei der Organisation der Praxiseinsätze und der Sicherstellung einer ausreichenden Praxisanleitung. Die Abstimmung zwischen Hochschulen, Pflegeschulen und Praxiseinrichtungen ist komplex und bedarf weiterer Optimierung, das braucht einfach seine Zeit.
Dr. Rester: Die Diskussion um das Für und Wider ist, zum Glück für die Weiterentwicklung eines Pflegesystems, leiser geworden.
QMP: Wie würden Sie die aktuellen Arbeitsbedingungen in der Pflege bewerten?
Dr. Aumer: Die Arbeitsbedingungen in der Pflege bleiben, wie in der Eingangsfrage ausführlich beantwortet, herausfordernd, insbesondere die Versorgungslücken und Versorgungsbrüche durch den anhaltenden Personalmangel und die hohe Arbeitsbelastung. Gleichzeitig setzen die aktuellen Reformen bei Bürokratieabbau und Kompetenzentwicklung an, um die Situation nachhaltig zu verbessern. Entscheidend wird sein, ob und wie schnell diese Maßnahmen in der Praxis greifen und spürbare Entlastung bringen. Es wäre wünschenswert, wenn mit den fachlichen Professionen gesprochen wird und nicht über sie. Nachhaltige Lösungen für unser krankes Gesundheitssystem können meiner Meinung nach nur gefunden werden, wenn auf Augenhöhe, orientiert am Bedarf der Menschen, gemeinsam offen mit den beteiligten Akteuren kommuniziert wird.
Dr. Rester: Die Frage kann und sollte meines Erachtens nur in die Zukunft gerichtet werden: Mit Verweis auf die angesprochene Selbstverantwortung könnten die Arbeitsbedingungen wenigstens selbst mitgestaltet und auch dadurch verbessert werden. Eine Pflegekammer ist dabei lediglich die Klammer für eine hierzu notwendige neue Denkweise gegenüber evidenzbasiertem Wissen, neuen Technologien sowie neuen Modellen der Arbeitsorganisation. Ich bleibe bewusst abstrakt. Zum einen, um den Rahmen des Interviews nicht zu sprengen. Zum anderen, weil ich unterstelle, dass alle Leser und Leserinnen hierfür jeweils eigene Beispiele – ob positiv oder negativ, ist unerheblich – vor Augen haben.
QMP: Was sind aus Ihrer Sicht die häufigsten Gründe für das Verlassen des Berufsfeldes?
Dr. Aumer: Die häufigsten Gründe, warum Pflegekräfte das Berufsfeld verlassen, sind gut erforscht. Kurz gesagt: Das Verlassen des Pflegeberufs ist meist das Ergebnis eines Zusammenspiels aus mehreren Faktoren und hängt viel von der Resilienz ab.
Neben hoher Arbeitsbelastung und Personalmangel, fehlender Wertschätzung und Anerkennung, erschwerter Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ist es vor allem die hohe psychische und physische Belastung, die zur Kündigung führt. Interessant ist, dass viele Pflegekräfte, wenn sie z. B. von Community Health Nursing hören, glänzende Augen bekommen:
Sie wünschen sich im Berufsalltag mehr Eigenverantwortung, echte Gestaltungsmöglichkeiten und die Chance, präventiv, beratend und kurativ tätig zu sein. Die Ganzheitlichkeit von der Bedarfsermittlung, Stärkung der Gesundheitskompetenz über die Begleitung in familiären Krisen, das Krankheitsmanagement sowie die Versorgungskoordination sagt ihnen zu. Denn hier können sie ihre fachlichen Kompetenzen voll einbringen und Verantwortung leben, statt im Hamsterrad der Überlastung zu verharren.
Mitunter führt auch die fehlende Mitbestimmung und Einflussmöglichkeit zur Resignation der Fachkräfte.
Dr. Rester: Auch diese Frage ist prospektiv zu formulieren: Daher ist eine, im Übrigen vom Pflegeberuf unabhängige, prozessuale Perspektive sowie die hohe Bedeutung von Bildung und Selbstverantwortung exemplarisch auch für Wertschätzung und Anerkennung zu ergänzen: Berufliche Veränderungen können von Pflegepersonen und auch deren Führungspersonen selbst gestaltet und beeinflusst werden. Dies geschieht meines Erachtens zu wenig und insbesondere nicht proaktiv.
QMP: Wie bewerten Sie die Aus- und Weiterbildung in der Pflege? Wie kann Ihrer Meinung nach die Qualität der Ausbildung verbessert werden?
Dr. Aumer: Die Pflegeausbildung in Deutschland ist auf einem guten Weg, benötigt aber weitere Entwicklungen, bessere Verzahnung von Theorie und Praxis, mehr Ressourcen für Praxisanleitung und weniger Bürokratie, um die Qualität nachhaltig zu sichern und den Pflegeberuf zu stärken.
Die geringe Akademisierungsquote und Nachfrage macht mir Sorgen: Trotz politischer Zielvorgaben ist der Anteil akademisch qualifizierter Pflegekräfte in Deutschland weiterhin sehr niedrig. Weniger als ein Prozent der Pflegekräfte in Pflegeheimen und ambulanten Diensten haben einen pflegewissenschaftlichen Abschluss. Hier braucht es Nachbesserungen der finanziellen, strukturellen und beruflichen Rahmenbedingungen. Insbesondere eine Vergütung der Praxiseinsätze, klare Karrierewege und gezielte politische Unterstützung sind entscheidend. Ausbildende Organisationen benötigen ausreichend finanzielle Mittel für Lehrpersonal, Simulationslabore und die Organisation der Praxisphasen, um eine hochwertige Ausbildung gewährleisten zu können.
Aber vor allem braucht es positive Vorbilder: Projekte wie CoSta in Hamburg, FAMOUS in Rheinland-Pfalz, die mittels fallbezogener Versorgung von multimorbiden Patientinnen und Patienten in der Hausarztpraxis durch Advanced Practice Nurses eindrucksvoll zeigen, dass akademisch qualifizierte Pflegekräfte Versorgungslücken schließen und die Versorgungsqualität verbessern können. ABER diese Projekte versanden, aufgrund fehlender Finanzierungsmöglichkeiten. Hier ist die Wurzel des Problems: viele wichtige Projekte, aber keine Verstetigung!!!
Sehr oft bleiben die Projekte auf einzelne Regionen oder Projektphasen beschränkt, weil es an politischer Unterstützung, klaren rechtlichen Rahmenbedingungen und verlässlicher Finanzierung mangelt. Damit solche Vorbilder echte Strahlkraft entfalten und mehr junge Menschen für ein Pflegestudium begeistern, müssen sie in die Regelversorgung überführt und bundesweit etabliert werden. Nur so kann die Attraktivität und Sichtbarkeit akademischer Pflege nachhaltig gesteigert werden.
Zudem braucht es Standards, klare Evidenz, weniger Variation zwischen den Bundesländern und Bildungseinrichtungen. Gut funktionierende Curricula sollten übernommen werden. Ohne verlässliche Daten bleibt z. B. unklar, wie wirksam Curricula sind, wo es Defizite gibt und welche Ansätze tatsächlich zu besseren Kompetenzen führen. Einheitliche Standards, klare Evidenz und weniger Variation zwischen Bundesländern und Bildungseinrichtungen sind entscheidend, um die Ausbildung auf hohem Niveau zu sichern und erfolgreiche Modelle gezielt zu verbreiten. Gut funktionierende Curricula sollten übernommen und kontinuierlich weiterentwickelt werden, damit alle Auszubildenden unabhängig vom Ausbildungsort vergleichbare und hochwertige Qualifikationen erwerben können.
Außerdem braucht es auch eine verbindliche und systematische Datenerhebung bezüglich Bildung, Einstiegsmöglichkeiten in die Praxis, aber genauso dringend in der Pflegeforschung und es braucht valide Daten zur interprofessionellen Zusammenarbeit.
Dr. Rester: Auch hier würde ich die Ausführungen von Frau Aumer lediglich um eine positive Perspektive ergänzen: Mittlerweile haben wir wenigstens ein erstes Wissen, z. B. zur Akademisierungsquote. Und wenigstens werden Pflegepersonen nach und nach von akademisch ausgebildeten Pflegepersonen unterrichtet.
QMP: Wie stehen Sie der Digitalisierung in der Pflege gegenüber? Bringen die technischen Neuerungen Erleichterung im Arbeitsalltag oder gestaltet sich die Einführung eher schwierig? Wo sehen Sie die größten Probleme für den Einsatz neuer Methoden und Technologien in der Praxis?
Dr. Aumer: Die Digitalisierung in der Pflege bietet großes Potenzial, den Arbeitsalltag für Pflegefachkräfte zu erleichtern und die Versorgungsqualität zu verbessern. Digitale Anwendungen wie die elektronische Patientenakte (ePA), digitale Pflegedokumentation und elektronische Medikationspläne ermöglichen eine effizientere Kommunikation, reduzieren Fehlerquellen und sparen Zeit bei Routineaufgaben. Dadurch bleibt mehr Zeit für die direkte Betreuung der Pflegebedürftigen, und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Berufsgruppen wird erleichtert.
Viele Studierende berichten, dass sie die Nutzung digitaler Technologien als Erleichterung empfinden, insbesondere bei der Dokumentation und beim Informationsaustausch. Insbesondere der Einsatz von Telemedizin und Telepflege gibt lt. der vom Bundesministerium für Gesundheit in Auftrag gegebenen Studie (IGES Institut, 2020), zahlreiche positive Effekte für die Pflegepraxis.
Die Einführung neuer Technologien allerdings, das wird mir auch berichtet, gestaltet sich in der Praxis oft schwierig. Die größten Probleme sind allem voran die unzureichende technische Infrastruktur. Vielerorts fehlt es an stabilem WLAN, besonders in ländlichen Regionen. Zudem sind die Anschaffung und der Betrieb digitaler Systeme häufig mit hohen Kosten verbunden. Und nicht zuletzt mangelt es teilweise an digitalen Kompetenzen bei allen Beteiligten, oder Vorbehalte gegenüber neuen Technologien sind zu überwinden.
Dr. Rester: Die Frage darf nicht lauten ob, sondern wie neue Technologien und Digitalisierung die Berufsausübung und in der Folge die Versorgungsqualität erhöhen. Das hierzu fehlende Mindset ist das größte Problem. Als Stiftung tragen wir u. a. mit Bürger- und Pflegemessen dazu bei, beruflich Pflegende sowie informell Sorgende und Pflegende hierfür zu sensibilisieren. Robotik, Exoskelette und virtuelle Realitäten in der Versorgung sowie in der beruflichen Pflegebildung sind exemplarische Beispiele hierfür.
QMP: Wie schätzen Sie die Zukunft der Pflege in Deutschland ein? Welche Perspektiven gibt es? Auch: Stichwort „Neue Versorgungskonzepte“?
Dr. Aumer: Die Zukunft der Pflege in Deutschland steht vor einem grundlegenden Wandel – und neue Versorgungskonzepte wie z. B. Community Health Nursing (CHN) können dabei ein wichtiger Baustein sein. Community Health Nursing ist ein neues, akademisch qualifiziertes pflegerisches Berufsbild, das darauf abzielt, die primäre Gesundheitsversorgung in Deutschland nachhaltig, wohnortnah und evidenzbasiert zu verbessern. CHNs sind Ansprechpartner für Menschen und Familien in jeder Lebenslage bei der Bewältigung von Krisen oder bei Gesundheitsfragen. Als Kernaufgaben und Arbeitsbereiche von Community Health Nurses sieht die Forschungsgruppe der THD:
- Bedarfsermittlung: CHNs analysieren systematisch den individuellen Versorgungsbedarf. Sie identifizieren gesundheitliche Risiken, Versorgungslücken und Ressourcen in der Familie.
- Gesundheitskompetenzförderung: Ein zentrales Ziel ist die Stärkung der Gesundheitskompetenz der Bevölkerung. CHNs beraten, schulen auch präventiv und begleiten Bürger einer Region, um gesundheitsförderliches Verhalten zu unterstützen und Eigenverantwortung zu stärken.
- Disease Management: CHNs übernehmen im Rahmen der ärztlichen Delegation die Versorgung chronischer Erkrankungen, führen Verlaufskontrollen und Monitoring durch, unterstützen bei der Therapietreue (Adhärenz) und koordinieren die Behandlung in enger Abstimmung mit dem Hausarzt und anderen Gesundheitsberufen.
- Versorgungskoordination: Sie organisieren und koordinieren die Versorgung über verschiedene Sektoren hinweg, sorgen für einen reibungslosen Informationsfluss und arbeiten eng mit allen Akteuren im Gesundheitswesen zusammen.
CHNs orientieren sich am konkreten regionalen Bedarf und binden vorhandene Ressourcen und Akteure des Gesundheitswesens aktiv ein. Sie fördern die sektorenübergreifende Zusammenarbeit und stärken die Gesundheitsversorgung vor Ort.
International ist CHN ein bewährtes Modell. In Ländern wie Kanada, Großbritannien oder Skandinavien sind Community Health Nurses etabliert und tragen maßgeblich zur Sicherung der Gesundheitsversorgung bei.
Dr. Rester: Dem CHN würde ich ebenfalls, auch aufgrund unserer Stiftungsarbeit zur Etablierung und Stärkung von Caring Communities, eine sehr hohe Bedeutung für die künftige Versorgung beimessen. Denn CHN stärkt Caring Communities, bindet informelle Sorge und Pflege konstitutiv ein und erfordert ein selbstbestimmtes und in der Regel auch selbstorganisiertes berufliches respektive pflegerisches Handeln. Zudem: Erste Eindrücke des seit Januar 2025 laufenden CHN-Projekts der Kollegin Aumer in Lindenberg zeigen, dass insbesondere Ärzte von der Professionalisierung der Pflege profitieren.
Kurz: CHN trägt zur Professionalisierung der Pflegeberufe bei, wobei ich in der angesprochenen Übergangsphase für eine Offenheit des Qualifikationsprofils von CHN plädiere, um die hoffentlich entstehenden Stellen in diesem Bereich auch besetzen zu können. Ein Blick auf die annähernd 1.000 Teams beim niederländischen Pflegedienst Buurtzorg und deren Variationen in der sozialraumorientierten Versorgung ist hier zu empfehlen.
QMP: Welche Unterstützung wünschen Sie sich, sowohl von Seiten der Politik als auch seitens der Gesellschaft?
Dr. Aumer: Seitens der Politik wünsche ich mir klare rechtliche Rahmenbedingungen, da es eindeutige gesetzliche Regelungen braucht, die neue Versorgungsmodelle wie Community Health Nursing, erweiterte Pflegekompetenzen und die Delegation heilkundlicher Tätigkeiten ermöglichen und absichern.
Noch dringlicher wünsche ich mir eine verlässliche und auskömmliche Finanzierung, damit geeignete Lösungsansätze wie CHN über den Projektstatus hinaus dauerhaft finanziert und in die Regelversorgung überführt werden können. Es braucht sichtbare Vorreiter, die von der Politik ernst genommen werden. Erfolgreiche Projekte und Pflegefachpersonen sollten als Vorbilder präsentiert werden, um junge Menschen für den Beruf zu begeistern.
Von der Gesellschaft erwarte ich ein Bewusstsein für die Bedeutung professioneller Pflege für das Gemeinwohl und die Bereitschaft, sich für deren Stärkung einzusetzen – durch Vertrauen in die Pflege, Mut und Aufgeschlossenheit für neue Wege – neue, international etablierte Versorgungsformen.
Für meine eigene Profession wünsche ich mir Selbstbewusstsein und Vertrauen in unsere fachlichen Kompetenzen, einen echten Schulterschluss mit allen Gesundheitsberufen, die nötige Stärke, auch Gegenwind standzuhalten und den Mut, gemeinsam neue Wege zu gehen.
Dr. Rester: Die von Frau Aumer angeführten Aspekte sind langfristig, parteiübergreifend und unabhängig von Legislaturperioden zu verfolgen. Exemplarisch: Das finnische Bildungssystem reformierte sich meines Wissens in den letzten zwei Dekaden entsprechend, wobei der Veränderungsprozess noch nicht abgeschlossen ist. Das heißt konkret, dass es auch nach zwei Jahrzehnten noch Lehrpersonen gibt, die den neuen Weg, z. B. einer erhöhten Selbstverantwortung von Schülerinnen und Schülern, nicht aktiv mitgestalten.
Von beruflich Pflegenden und deren Interessenvertreter erwarte ich, Gesundheitsförderung und Prävention sowie informeller und für das CHN sozialraumorientierter Sorge und Pflege einen höheren Stellenwert beizumessen. Exemplarisch: Bei Buurtzorg ist es Ziel, die Kontaktzeit je Klient-/in zu reduzieren.
QMP: Vielen Dank für das Gespräch.
Dr. Christine Aumer ist derzeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Pflege der Fakultät Angewandte Gesundheitswissenschaften an der TH Deggendorf tätig. Sie ist staatl.
Exam. Gesundheits- und Krankenpflegerin, Dipl. Pflegewirtin (FH) und promovierte Pflegewissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Gerontologie. Ihre Forschungsschwerpunkte sind außerklinische Gesundheitsversorgung, Community Health Nursing, interprofessionelle Zusammenarbeit, Gesundheitskompetenz sowie Digitalisierung in der häuslichen Versorgung.
Dr. David Rester war zehn Jahre in der beruflichen Pflege, vorwiegend in der neurologischen Frührehabilitation, tätig. Als promovierter Pflegewissenschaftler mit dem Schwerpunkt Gerontologie lehrt er seit 2010 für Sozial-, Pflege- und Gesundheitsberufe an verschiedenen Hochschulen, u. a. im multidisziplinären Promotionsprogramm an der UMIT in Hall in Tirol und im
primärqualifizierenden Bachelorstudiengang Pflege an der TH Deggendorf. Von 2012 bis 2018 vertrat er die Professur für Management im Gesundheits- und Pflegesystem an der WH in Zwickau. Seine Arbeitsschwerpunkte sowie Lehr- und Forschungsinteressen fokussieren wesentlich eine sozialraumorientierte Sorge und Pflege für ein Community (Health) Caring/Nursing. Seit 2018 realisiert er dies als Projektentwickler bei der Lars und Christian Engel Stiftung in Weiherhammer zur Stärkung und Etablierung von Caring Communities im ländlichen Raum und als Projektleiter im Rahmen verschiedener zugehöriger Modell- und Transferprojekte.