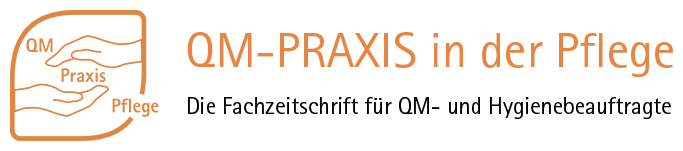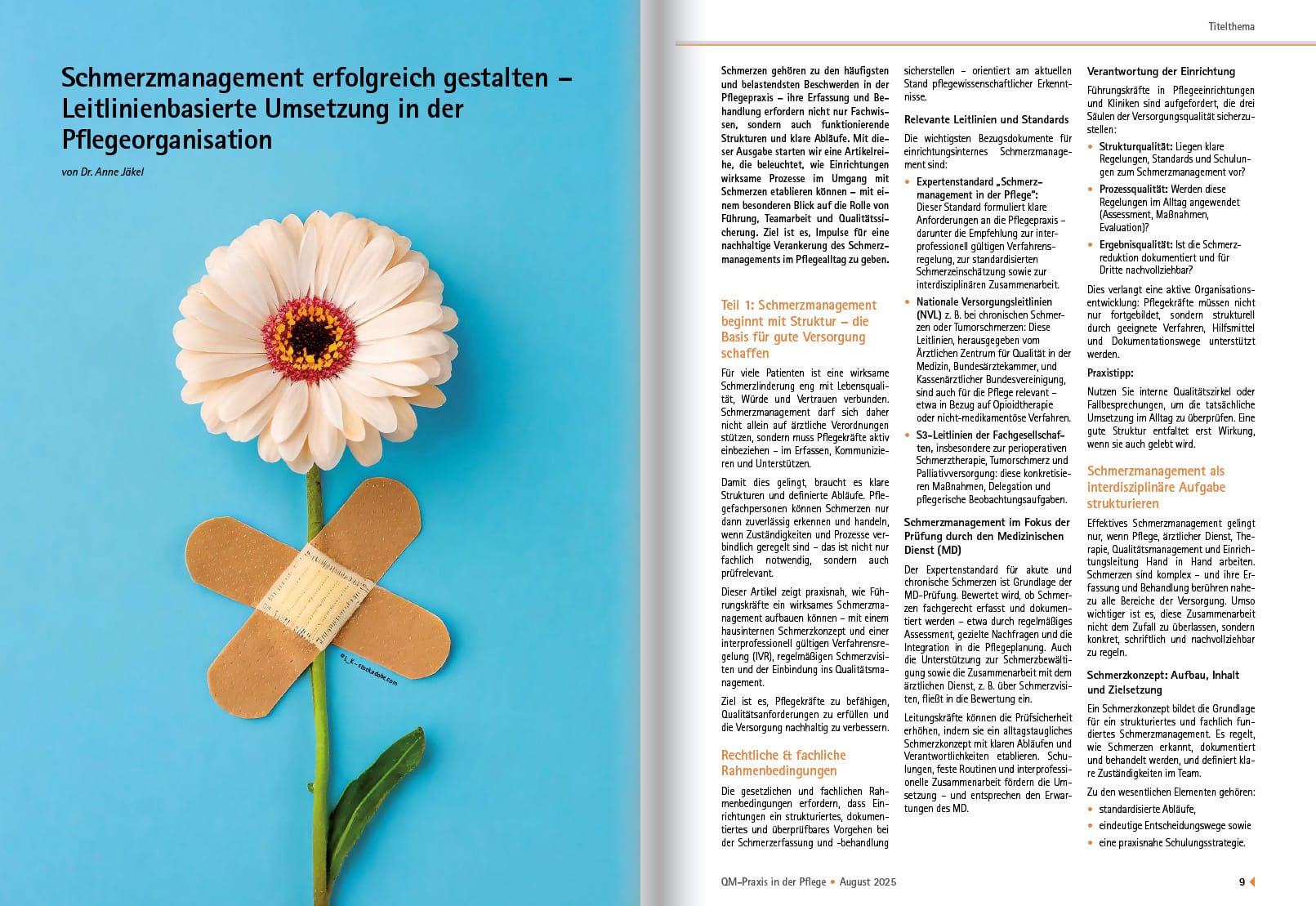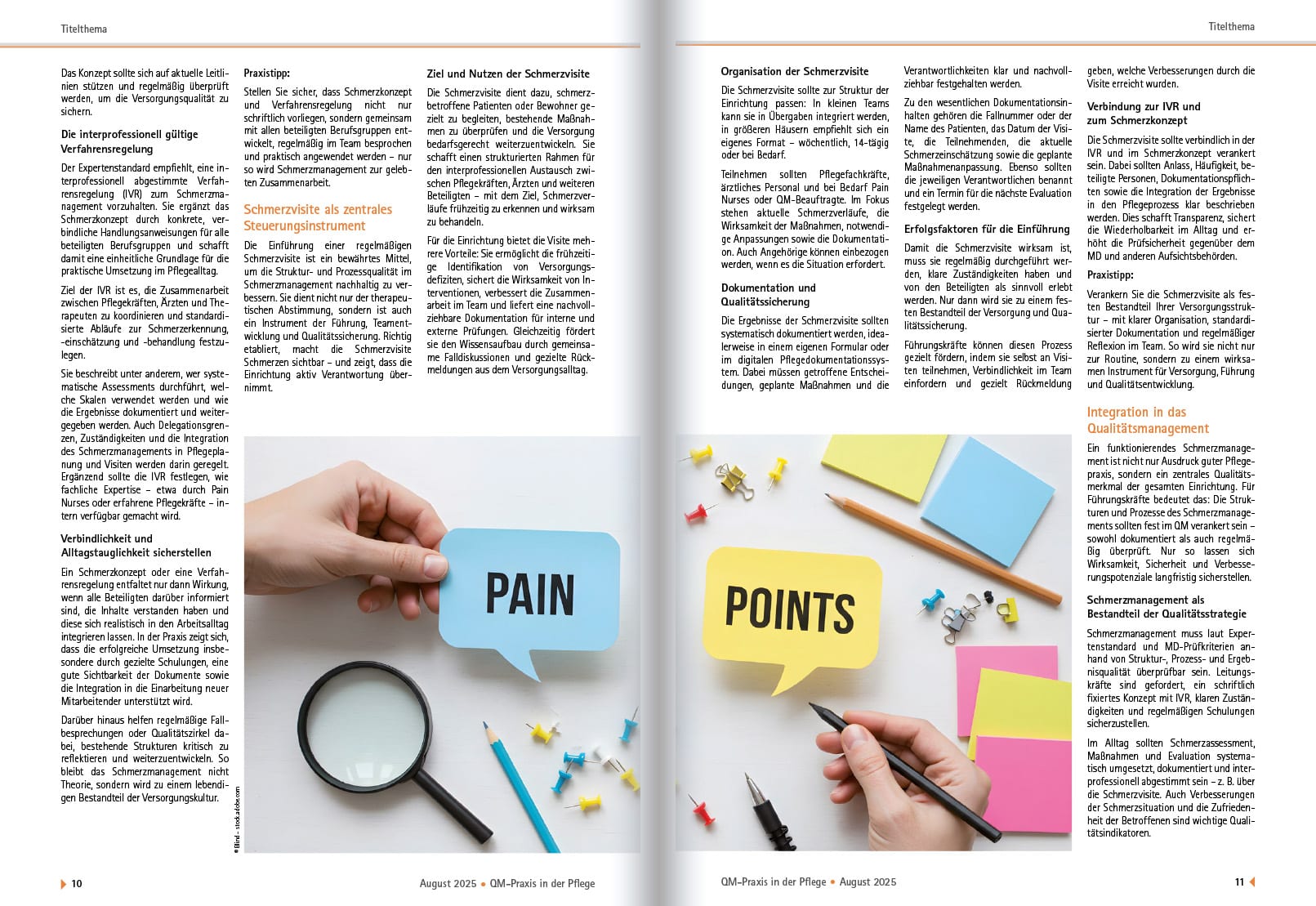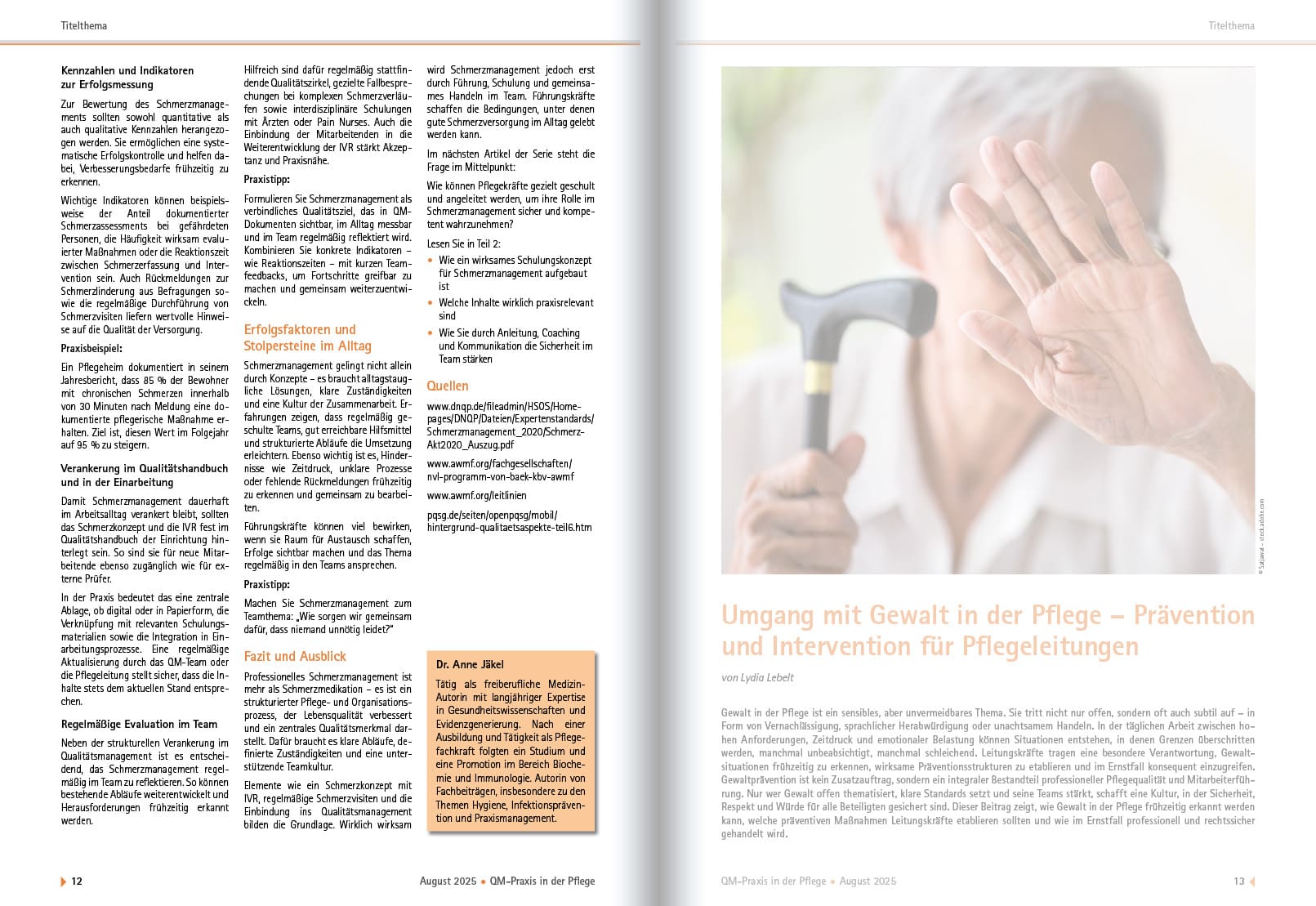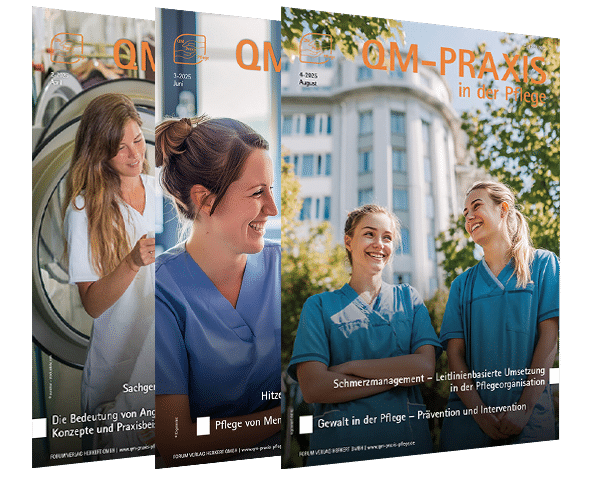PflegePRAXIS
Schmerzmanagement erfolgreich gestalten – Leitlinienbasierte Umsetzung in der Pflegeorganisation
Text: Dr. Anne Jäkel | Foto (Header): © Sasha Brazhnik – stock.adobe.com
Schmerzen gehören zu den häufigsten und belastendsten Beschwerden in der Pflegepraxis – ihre Erfassung und Behandlung erfordern nicht nur Fachwissen, sondern auch funktionierende Strukturen und klare Abläufe. Mit dieser Ausgabe starten wir eine Artikelreihe, die beleuchtet, wie Einrichtungen wirksame Prozesse im Umgang mit Schmerzen etablieren können – mit einem besonderen Blick auf die Rolle von Führung, Teamarbeit und Qualitätssicherung. Ziel ist es, Impulse für eine nachhaltige Verankerung des Schmerzmanagements im Pflegealltag zu geben.
Auszug aus:
QM Praxis in der Pflege
Ausgabe August 2025
Jetzt Leser/-in werden
INHALTE DES BEITRAGS
Teil 1: Schmerzmanagement beginnt mit Struktur – die Basis für gute Versorgung schaffen
Rechtliche & fachliche Rahmenbedingungen
Schmerzmanagement als interdisziplinäre Aufgabe strukturieren
Schmerzvisite als zentrales Steuerungsinstrument
Integration in das Qualitätsmanagement
Erfolgsfaktoren und Stolpersteine im Alltag
Fazit und Ausblick
Quellen
Teil 1: Schmerzmanagement beginnt mit Struktur – die Basis für gute Versorgung schaffen
Für viele Patienten ist eine wirksame Schmerzlinderung eng mit Lebensqualität, Würde und Vertrauen verbunden. Schmerzmanagement darf sich daher nicht allein auf ärztliche Verordnungen stützen, sondern muss Pflegekräfte aktiv einbeziehen – im Erfassen, Kommunizieren und Unterstützen.
Damit dies gelingt, braucht es klare Strukturen und definierte Abläufe. Pflegefachpersonen können Schmerzen nur dann zuverlässig erkennen und handeln, wenn Zuständigkeiten und Prozesse verbindlich geregelt sind – das ist nicht nur fachlich notwendig, sondern auch prüfrelevant.
Dieser Artikel zeigt praxisnah, wie Führungskräfte ein wirksames Schmerzmanagement aufbauen können – mit einem hausinternen Schmerzkonzept und einer interprofessionell gültigen Verfahrensregelung (IVR), regelmäßigen Schmerzvisiten und der Einbindung ins Qualitätsmanagement.
Ziel ist es, Pflegekräfte zu befähigen, Qualitätsanforderungen zu erfüllen und die Versorgung nachhaltig zu verbessern.
Rechtliche & fachliche Rahmenbedingungen
Die gesetzlichen und fachlichen Rahmenbedingungen erfordern, dass Einrichtungen ein strukturiertes, dokumentiertes und überprüfbares Vorgehen bei der Schmerzerfassung und -behandlung sicherstellen – orientiert am aktuellen Stand pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse.
Relevante Leitlinien und Standards
Die wichtigsten Bezugsdokumente für einrichtungsinternes Schmerzmanagement sind:
• Expertenstandard „Schmerzmanagement in der Pflege“: Dieser Standard formuliert klare Anforderungen an die Pflegepraxis – darunter die Empfehlung zur interprofessionell gültigen Verfahrensregelung, zur standardisierten Schmerzeinschätzung sowie zur interdisziplinären Zusammenarbeit.
• Nationale Versorgungsleitlinien (NVL) z. B. bei chronischen Schmerzen oder Tumorschmerzen: Diese Leitlinien, herausgegeben vom Ärztlichen Zentrum für Qualität in der Medizin, Bundesärztekammer, und Kassenärztlicher Bundesvereinigung, sind auch für die Pflege relevant – etwa in Bezug auf Opioidtherapie oder nicht-medikamentöse Verfahren.
• S3-Leitlinien der Fachgesellschaften, insbesondere zur perioperativen Schmerztherapie, Tumorschmerz und Palliativversorgung: diese konkretisieren Maßnahmen, Delegation und pflegerische Beobachtungsaufgaben.
Schmerzmanagement im Fokus der Prüfung durch den Medizinischen Dienst (MD)
Der Expertenstandard für akute und chronische Schmerzen ist Grundlage der MD-Prüfung. Bewertet wird, ob Schmerzen fachgerecht erfasst und dokumentiert werden – etwa durch regelmäßiges Assessment, gezielte Nachfragen und die Integration in die Pflegeplanung. Auch die Unterstützung zur Schmerzbewältigung sowie die Zusammenarbeit mit dem ärztlichen Dienst, z. B. über Schmerzvisiten, fließt in die Bewertung ein.
Leitungskräfte können die Prüfsicherheit erhöhen, indem sie ein alltagstaugliches Schmerzkonzept mit klaren Abläufen und Verantwortlichkeiten etablieren. Schulungen, feste Routinen und interprofessionelle Zusammenarbeit fördern die Umsetzung – und entsprechen den Erwartungen des MD.
Verantwortung der Einrichtung
Führungskräfte in Pflegeeinrichtungen und Kliniken sind aufgefordert, die drei Säulen der Versorgungsqualität sicherzustellen:
• Strukturqualität: Liegen klare Regelungen, Standards und Schulungen zum Schmerzmanagement vor?
• Prozessqualität: Werden diese Regelungen im Alltag angewendet (Assessment, Maßnahmen, Evaluation)?
• Ergebnisqualität: Ist die Schmerzreduktion dokumentiert und für Dritte nachvollziehbar?
Dies verlangt eine aktive Organisationsentwicklung: Pflegekräfte müssen nicht nur fortgebildet, sondern strukturell durch geeignete Verfahren, Hilfsmittel und Dokumentationswege unterstützt werden.
Praxistipp:
Nutzen Sie interne Qualitätszirkel oder Fallbesprechungen, um die tatsächliche Umsetzung im Alltag zu überprüfen. Eine gute Struktur entfaltet erst Wirkung, wenn sie auch gelebt wird.
Schmerzmanagement als interdisziplinäre Aufgabe strukturieren
Effektives Schmerzmanagement gelingt nur, wenn Pflege, ärztlicher Dienst, Therapie, Qualitätsmanagement und Einrichtungsleitung Hand in Hand arbeiten. Schmerzen sind komplex – und ihre Erfassung und Behandlung berühren nahezu alle Bereiche der Versorgung. Umso wichtiger ist es, diese Zusammenarbeit nicht dem Zufall zu überlassen, sondern konkret, schriftlich und nachvollziehbar zu regeln.
Schmerzkonzept: Aufbau, Inhalt und Zielsetzung
Ein Schmerzkonzept bildet die Grundlage für ein strukturiertes und fachlich fundiertes Schmerzmanagement. Es regelt, wie Schmerzen erkannt, dokumentiert und behandelt werden, und definiert klare Zuständigkeiten im Team.
Zu den wesentlichen Elementen gehören:
• standardisierte Abläufe,
• eindeutige Entscheidungswege sowie
• eine praxisnahe Schulungsstrategie.
Das Konzept sollte sich auf aktuelle Leitlinien stützen und regelmäßig überprüft werden, um die Versorgungsqualität zu sichern.
Die interprofessionell gültige Verfahrensregelung
Der Expertenstandard empfiehlt, eine interprofessionell abgestimmte Verfahrensregelung (IVR) zum Schmerzmanagement vorzuhalten. Sie ergänzt das Schmerzkonzept durch konkrete, verbindliche Handlungsanweisungen für alle beteiligten Berufsgruppen und schafft damit eine einheitliche Grundlage für die praktische Umsetzung im Pflegealltag.
Ziel der IVR ist es, die Zusammenarbeit zwischen Pflegekräften, Ärzten und Therapeuten zu koordinieren und standardisierte Abläufe zur Schmerzerkennung, -einschätzung und -behandlung festzulegen.
Sie beschreibt unter anderem, wer systematische Assessments durchführt, welche Skalen verwendet werden und wie die Ergebnisse dokumentiert und weitergegeben werden. Auch Delegationsgrenzen, Zuständigkeiten und die Integration des Schmerzmanagements in Pflegeplanung und Visiten werden darin geregelt. Ergänzend sollte die IVR festlegen, wie fachliche Expertise – etwa durch Pain Nurses oder erfahrene Pflegekräfte – intern verfügbar gemacht wird.
Verbindlichkeit und Alltagstauglichkeit sicherstellen
Ein Schmerzkonzept oder eine Verfahrensregelung entfaltet nur dann Wirkung, wenn alle Beteiligten darüber informiert sind, die Inhalte verstanden haben und diese sich realistisch in den Arbeitsalltag integrieren lassen. In der Praxis zeigt sich, dass die erfolgreiche Umsetzung insbesondere durch gezielte Schulungen, eine gute Sichtbarkeit der Dokumente sowie die Integration in die Einarbeitung neuer Mitarbeitender unterstützt wird.
Darüber hinaus helfen regelmäßige Fallbesprechungen oder Qualitätszirkel dabei, bestehende Strukturen kritisch zu reflektieren und weiterzuentwickeln. So bleibt das Schmerzmanagement nicht Theorie, sondern wird zu einem lebendigen Bestandteil der Versorgungskultur.
Praxistipp:
Stellen Sie sicher, dass Schmerzkonzept und Verfahrensregelung nicht nur schriftlich vorliegen, sondern gemeinsam mit allen beteiligten Berufsgruppen entwickelt, regelmäßig im Team besprochen und praktisch angewendet werden – nur so wird Schmerzmanagement zur gelebten Zusammenarbeit.
Schmerzvisite als zentrales Steuerungsinstrument
Die Einführung einer regelmäßigen Schmerzvisite ist ein bewährtes Mittel, um die Struktur- und Prozessqualität im Schmerzmanagement nachhaltig zu verbessern. Sie dient nicht nur der therapeutischen Abstimmung, sondern ist auch ein Instrument der Führung, Teamentwicklung und Qualitätssicherung. Richtig etabliert, macht die Schmerzvisite Schmerzen sichtbar – und zeigt, dass die Einrichtung aktiv Verantwortung übernimmt.
Ziel und Nutzen der Schmerzvisite
Die Schmerzvisite dient dazu, schmerzbetroffene Patienten oder Bewohner gezielt zu begleiten, bestehende Maßnahmen zu überprüfen und die Versorgung bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Sie schafft einen strukturierten Rahmen für den interprofessionellen Austausch zwischen Pflegekräften, Ärzten und weiteren Beteiligten – mit dem Ziel, Schmerzverläufe frühzeitig zu erkennen und wirksam zu behandeln.
Für die Einrichtung bietet die Visite mehrere Vorteile: Sie ermöglicht die frühzeitige Identifikation von Versorgungsdefiziten, sichert die Wirksamkeit von Interventionen, verbessert die Zusammenarbeit im Team und liefert eine nachvollziehbare Dokumentation für interne und externe Prüfungen. Gleichzeitig fördert sie den Wissensaufbau durch gemeinsame Falldiskussionen und gezielte Rückmeldungen aus dem Versorgungsalltag.
Organisation der Schmerzvisite
Die Schmerzvisite sollte zur Struktur der Einrichtung passen: In kleinen Teams kann sie in Übergaben integriert werden, in größeren Häusern empfiehlt sich ein eigenes Format – wöchentlich, 14-tägig oder bei Bedarf.
Teilnehmen sollten Pflegefachkräfte, ärztliches Personal und bei Bedarf Pain Nurses oder QM-Beauftragte. Im Fokus stehen aktuelle Schmerzverläufe, die Wirksamkeit der Maßnahmen, notwendige Anpassungen sowie die Dokumentation. Auch Angehörige können einbezogen werden, wenn es die Situation erfordert.
Dokumentation und Qualitätssicherung
Die Ergebnisse der Schmerzvisite sollten systematisch dokumentiert werden, idealerweise in einem eigenen Formular oder im digitalen Pflegedokumentationssystem. Dabei müssen getroffene Entscheidungen, geplante Maßnahmen und die Verantwortlichkeiten klar und nachvollziehbar festgehalten werden.
Zu den wesentlichen Dokumentationsinhalten gehören die Fallnummer oder der Name des Patienten, das Datum der Visite, die Teilnehmenden, die aktuelle Schmerzeinschätzung sowie die geplante Maßnahmenanpassung. Ebenso sollten die jeweiligen Verantwortlichen benannt und ein Termin für die nächste Evaluation festgelegt werden.
Erfolgsfaktoren für die Einführung
Damit die Schmerzvisite wirksam ist, muss sie regelmäßig durchgeführt werden, klare Zuständigkeiten haben und von den Beteiligten als sinnvoll erlebt werden. Nur dann wird sie zu einem festen Bestandteil der Versorgung und Qualitätssicherung.
Führungskräfte können diesen Prozess gezielt fördern, indem sie selbst an Visiten teilnehmen, Verbindlichkeit im Team einfordern und gezielt Rückmeldung geben, welche Verbesserungen durch die Visite erreicht wurden.
Verbindung zur IVR und zum Schmerzkonzept
Die Schmerzvisite sollte verbindlich in der IVR und im Schmerzkonzept verankert sein. Dabei sollten Anlass, Häufigkeit, beteiligte Personen, Dokumentationspflichten sowie die Integration der Ergebnisse in den Pflegeprozess klar beschrieben werden. Dies schafft Transparenz, sichert die Wiederholbarkeit im Alltag und erhöht die Prüfsicherheit gegenüber dem MD und anderen Aufsichtsbehörden.
Praxistipp:
Verankern Sie die Schmerzvisite als festen Bestandteil Ihrer Versorgungsstruktur – mit klarer Organisation, standardisierter Dokumentation und regelmäßiger Reflexion im Team. So wird sie nicht nur zur Routine, sondern zu einem wirksamen Instrument für Versorgung, Führung und Qualitätsentwicklung.
Integration in das Qualitätsmanagement
Ein funktionierendes Schmerzmanagement ist nicht nur Ausdruck guter Pflegepraxis, sondern ein zentrales Qualitätsmerkmal der gesamten Einrichtung. Für Führungskräfte bedeutet das: Die Strukturen und Prozesse des Schmerzmanagements sollten fest im QM verankert sein – sowohl dokumentiert als auch regelmäßig überprüft. Nur so lassen sich Wirksamkeit, Sicherheit und Verbesserungspotenziale langfristig sicherstellen.
Schmerzmanagement als Bestandteil der Qualitätsstrategie
Schmerzmanagement muss laut Expertenstandard und MD-Prüfkriterien anhand von Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität überprüfbar sein. Leitungskräfte sind gefordert, ein schriftlich fixiertes Konzept mit IVR, klaren Zuständigkeiten und regelmäßigen Schulungen sicherzustellen.
Im Alltag sollten Schmerzassessment, Maßnahmen und Evaluation systematisch umgesetzt, dokumentiert und interprofessionell abgestimmt sein – z. B. über die Schmerzvisite. Auch Verbesserungen der Schmerzsituation und die Zufriedenheit der Betroffenen sind wichtige Qualitätsindikatoren.
Kennzahlen und Indikatoren zur Erfolgsmessung
Zur Bewertung des Schmerzmanagements sollten sowohl quantitative als auch qualitative Kennzahlen herangezogen werden. Sie ermöglichen eine systematische Erfolgskontrolle und helfen dabei, Verbesserungsbedarfe frühzeitig zu erkennen.
Wichtige Indikatoren können beispielsweise der Anteil dokumentierter Schmerzassessments bei gefährdeten Personen, die Häufigkeit wirksam evaluierter Maßnahmen oder die Reaktionszeit zwischen Schmerzerfassung und Intervention sein. Auch Rückmeldungen zur Schmerzlinderung aus Befragungen sowie die regelmäßige Durchführung von Schmerzvisiten liefern wertvolle Hinweise auf die Qualität der Versorgung.
Praxisbeispiel:
Ein Pflegeheim dokumentiert in seinem Jahresbericht, dass 85 % der Bewohner mit chronischen Schmerzen innerhalb von 30 Minuten nach Meldung eine dokumentierte pflegerische Maßnahme erhalten. Ziel ist, diesen Wert im Folgejahr auf 95 % zu steigern.
Verankerung im Qualitätshandbuch und in der Einarbeitung
Damit Schmerzmanagement dauerhaft im Arbeitsalltag verankert bleibt, sollten das Schmerzkonzept und die IVR fest im Qualitätshandbuch der Einrichtung hinterlegt sein. So sind sie für neue Mitarbeitende ebenso zugänglich wie für externe Prüfer.
In der Praxis bedeutet das eine zentrale Ablage, ob digital oder in Papierform, die Verknüpfung mit relevanten Schulungsmaterialien sowie die Integration in Einarbeitungsprozesse. Eine regelmäßige Aktualisierung durch das QM-Team oder die Pflegeleitung stellt sicher, dass die Inhalte stets dem aktuellen Stand entsprechen.
Regelmäßige Evaluation im Team
Neben der strukturellen Verankerung im Qualitätsmanagement ist es entscheidend, das Schmerzmanagement regelmäßig im Team zu reflektieren. So können bestehende Abläufe weiterentwickelt und Herausforderungen frühzeitig erkannt werden.
Hilfreich sind dafür regelmäßig stattfindende Qualitätszirkel, gezielte Fallbesprechungen bei komplexen Schmerzverläufen sowie interdisziplinäre Schulungen mit Ärzten oder Pain Nurses. Auch die Einbindung der Mitarbeitenden in die Weiterentwicklung der IVR stärkt Akzeptanz und Praxisnähe.
Praxistipp:
Formulieren Sie Schmerzmanagement als verbindliches Qualitätsziel, das in QM-Dokumenten sichtbar, im Alltag messbar und im Team regelmäßig reflektiert wird. Kombinieren Sie konkrete Indikatoren – wie Reaktionszeiten – mit kurzen Teamfeedbacks, um Fortschritte greifbar zu machen und gemeinsam weiterzuentwickeln.
Erfolgsfaktoren und Stolpersteine im Alltag
Schmerzmanagement gelingt nicht allein durch Konzepte – es braucht alltagstaugliche Lösungen, klare Zuständigkeiten und eine Kultur der Zusammenarbeit. Erfahrungen zeigen, dass regelmäßig geschulte Teams, gut erreichbare Hilfsmittel und strukturierte Abläufe die Umsetzung erleichtern. Ebenso wichtig ist es, Hindernisse wie Zeitdruck, unklare Prozesse oder fehlende Rückmeldungen frühzeitig zu erkennen und gemeinsam zu bearbeiten.
Führungskräfte können viel bewirken, wenn sie Raum für Austausch schaffen, Erfolge sichtbar machen und das Thema regelmäßig in den Teams ansprechen.
Praxistipp:
Machen Sie Schmerzmanagement zum Teamthema: „Wie sorgen wir gemeinsam dafür, dass niemand unnötig leidet?“
Fazit und Ausblick
Professionelles Schmerzmanagement ist mehr als Schmerzmedikation – es ist ein strukturierter Pflege- und Organisationsprozess, der Lebensqualität verbessert und ein zentrales Qualitätsmerkmal darstellt. Dafür braucht es klare Abläufe, definierte Zuständigkeiten und eine unterstützende Teamkultur.
Elemente wie ein Schmerzkonzept mit IVR, regelmäßige Schmerzvisiten und die Einbindung ins Qualitätsmanagement bilden die Grundlage. Wirklich wirksam wird Schmerzmanagement jedoch erst durch Führung, Schulung und gemeinsames Handeln im Team. Führungskräfte schaffen die Bedingungen, unter denen gute Schmerzversorgung im Alltag gelebt werden kann.
Im nächsten Artikel der Serie steht die Frage im Mittelpunkt:
Wie können Pflegekräfte gezielt geschult und angeleitet werden, um ihre Rolle im Schmerzmanagement sicher und kompetent wahrzunehmen?
Lesen Sie in Teil 2:
• Wie ein wirksames Schulungskonzept für Schmerzmanagement aufgebaut ist
• Welche Inhalte wirklich praxisrelevant sind
• Wie Sie durch Anleitung, Coaching und Kommunikation die Sicherheit im Team stärken
Quellen
www.awmf.org/fachgesellschaften/nvl-programm-von-baek-kbv-awmf
pqsg.de/seiten/openpqsg/mobil/hintergrund-qualitaetsaspekte-teil6.htm
Die Autorin
Dr. Anne Jäkel
Tätig als freiberufliche Medizin-Autorin mit langjähriger Expertise in Gesundheitswissenschaften und Evidenzgenerierung. Nach einer Ausbildung und Tätigkeit als Pflegefachkraft folgten ein Studium und eine Promotion im Bereich Biochemie und Immunologie. Autorin von Fachbeiträgen, insbesondere zu den Themen Hygiene, Infektionsprävention und Praxismanagement.